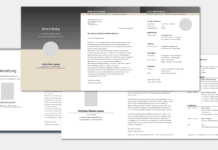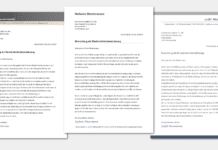Soziale Angst kann den Alltag zu einer Herausforderung machen. Egal, ob es um Situationen in Job, Studium oder Schule geht – damit eine soziale Phobie überwunden werden kann, ist es wichtig, die richtigen Strategien an der Hand zu haben. Hier findest du Tipps, um konstruktiv mit deinen Ängsten umzugehen.
Inhaltsübersicht:
Soziale Phobie: Was ist das?
Bei einer sozialen Phobie haben die Betroffenen in sozialen Situationen Ängste, die oft über ein normales Maß hinausgehen. Sie fühlen sich unwohl, fürchten, abgelehnt zu werden, und treten oft schüchtern oder nervös auf. Die Betroffenen machen sich stärker als andere Gedanken darüber, wie andere Menschen sie wahrnehmen. Ihre sozialen Ängste können dazu führen, dass sie sich kritisch beäugt fühlen oder das Gefühl haben, dass andere sie genau beobachten, obwohl das womöglich gar nicht der Fall ist.
In Interaktionen mit anderen – vor allem mit unbekannten oder flüchtig bekannten Personen – treten Menschen mit sozialer Phobie oft zurückhaltend auf. Sie meiden häufig Blickkontakt, sprechen leise, stottern oder verlieren den Faden. Dabei haben sie oft Angst, etwas Falsches zu sagen oder sich zu blamieren. Körperliche Symptome wie Schwitzen, Zittern oder ein schneller Herzschlag können hinzukommen und die Ängste noch verstärken.
Über eine normale Schüchternheit geht die Symptomatik bei einer sozialen Phobie weit hinaus. Die Ängste der Betroffenen sind wesentlich ausgeprägter, die Einschränkungen und Belastungen im täglichen Leben weitaus größer. Schüchterne Menschen sind zwar auch in vielen Situationen nervös, stellen sich diesen aber häufig trotzdem – Menschen mit sozialer Phobie gehen ihnen hingegen konsequent aus dem Weg.
Die sozialen Ängste der Betroffenen sind oft so groß, dass sie bestimmte Situationen von vornherein meiden. Sie gehen nicht zu Partys, Feiern oder Netzwerktreffen. Das kann dazu führen, dass sich die Betroffenen zunehmend isoliert fühlen. Sie haben es oft schwerer, Freundschaften zu schließen und neue Menschen kennenzulernen. Mitunter macht ihnen ihr Meidungsverhalten in Schule, Studium oder Job ernsthafte Probleme.
Eine soziale Phobie hat häufig tiefgreifende Auswirkungen. Die Betroffenen haben meist ein geringes Selbstwertgefühl und sind nicht selbstbewusst. Oft zweifeln sie an sich und ihren Fähigkeiten, was die Angst vor zwischenmenschlichen Kontakten zusätzlich verstärken kann.
Soziale Angst: Symptome und Anzeichen
„Nur“ schüchtern? Damit hat eine echte soziale Phobie wenig gemein. Wenn hinter der Schüchternheit eine Angststörung steckt, ist es wichtig, das zu erkennen und etwas dagegen zu unternehmen. Es gibt verschiedene psychische, soziale und körperliche Symptome der sozialen Phobie, auf die du achten solltest.
Psychische und soziale Symptome, die auf eine soziale Phobie hindeuten können:
- Starke Angst davor, dass andere einen negativ bewerten könnten (und der feste, irrationale Glaube daran, dass das tatsächlich der Fall ist)
- Übermäßige Angst vor Kritik
- Angst, sich zu blamieren
- Meidungsverhalten: bestimmte soziale Situationen werden nach Möglichkeit gemieden (etwa Geburtstagsfeiern und andere Feiern, Partys, Jobevents)
- Überzogene Selbstkritik
- Geringes Selbstwertgefühl
- Geringes Selbstbewusstsein
- Starke Sorgen im Vorfeld von sozialen Ereignissen
- Verzerrte Wahrnehmungen
- Isolation und sozialer Rückzug
Soziale Phobie: Symptome körperlicher Natur
- Herzrasen, schneller Puls
- Schwitzen, Hitzewallungen
- Übelkeit
- Zittern
- Magen-Darm-Beschwerden
- Stottern
Was hat eine soziale Phobie für Ursachen?
Soziale Ängste und Phobien haben häufig vielfältige Ursachen. Eine soziale Phobie ist meist die Folge von verschiedenen Faktoren, die zusammenspielen. Diese Aspekte können sowohl genetischals auch psychologisch bedingt sein. Auch Umwelteinflüsse spielen in vielen Fällen eine wichtige Rolle.
Studien legen nahe, dass soziale Phobien eine erbliche Komponente aufweisen, da sie in Familien gehäuft auftreten können. Dabei können auch neurobiologische Prozesse ursächlich beteiligt sein. Forscher nehmen an, dass eine Überaktivität der Amygdala soziale Phobien begünstigen kann. Die Amygdala, auch Mandelkern genannt, ist Teil des limbischen Systems. Bei der Verarbeitung von Emotionen spielt sie eine entscheidende Rolle. Das kann zur Folge haben, dass Menschen mit sozialen Ängsten auf soziale Reize empfindlicher reagieren als andere.
Ob es zu einer ausgeprägten sozialen Phobie kommt, hängt häufig davon ab, welche Erfahrungen Menschen im Laufe ihrer Kindheit und des Heranwachsens machen. Traumatische Erlebnisse können soziale Ängste begünstigen, etwa Mobbing oder Ablehnung durch bestimmte Gruppen. Auch übermäßige Kritik oder Hänseln können dazu führen, dass Menschen sich vor sozialen Interaktionen fürchten. Nicht nur eine besonders strenge, sondern auch eine besonders behütete Erziehung kann das Selbstwertgefühl der Betroffenen negativ beeinflussen und die Ausbildung von Ängsten begünstigen.
Zu den Ursachen von sozialen Phobien gehören auch Persönlichkeitsmuster. Persönliche Merkmale haben einen Einfluss darauf, wer eine Sozialphobie entwickelt. Negative Denkmuster sind ein Faktor, ebenso Perfektionismus und Schüchternheit. Menschen mit einer sozialen Phobie neigen dazu, sich besonders kritisch zu sehen und ihre Fähigkeiten und ihren Wert zu unterschätzen.
Häufig stecken Menschen mit sozialen Ängsten in einem Teufelskreis: Sie haben Angst, schlechte Erfahrungen in sozialen Interaktionen zu machen, und meiden diese. Dadurch haben sie aber nicht die Möglichkeit, gute Erfahrungen zu machen, die ihre Ängste durchbrechen könnte. Die Folge: Die Ängste verstärken sich mit der Zeit oft zunehmend.
Soziale Ängste bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Soziale Angststörungen sind ein Thema, das Jugendliche und junge Erwachsenen häufig besonders stark betrifft. Die Adoleszenz ist ein Lebensabschnitt, in dem soziale Anerkennung vielen Menschen besonders wichtig ist: Man sehnt sich danach, dazuzugehören. Zugleich ist das Selbstbewusstsein oft noch nicht so ausgeprägt, wie es im höheren Alter der Fall ist. Und es mangelt in vielen Fällen an weitreichenden Erfahrungen im Umgang mit bestimmten Situationen, was die Neigung zu negativen Gedanken, Selbstzweifeln und Ängsten verstärken kann.
Gerade Jugendliche haben oft große Angst, dass andere sie ablehnen oder ausgrenzen könnten. Auch die Pubertät mit ihren körperlichen und hormonellen Veränderungen spielt dabei eine wichtige Rolle: Sie kann dazu führen, dass Jugendliche sich nicht wohl in ihrer Haut fühlen, was soziale Ängste und Sozialphobien begünstigen kann.
Die Jugend und das junge Erwachsenenalter sind darüber hinaus Zeiten, die von vielen Veränderungen geprägt sind. Die Schule endet, was auch soziale Auswirkungen hat: In der Ausbildung oder im Studium ist man auf einmal nicht mehr von den gewohnten Menschen umgeben, sondern muss sich neu einfügen. Genauso ist es, wenn jemand seinen ersten „richtigen“ Job antritt. Solche Herausforderungen können soziale Ängste hervorrufen und verstärken.
Anzeichen für soziale Phobie ernstnehmen – und rechtzeitig handeln
Jungen Menschen mit einer sozialen Phobie fällt es schwerer, neue Kontakte zu knüpfen. In Schule, Ausbildung und Studium tun sie sich meist schwer damit, sich einzubringen und in das neue Umfeld zu integrieren. Sie melden sich nicht zu Wort, halten sich bei Gruppenaufgaben zurück und trauen sich nicht, vor anderen zu sprechen. Auch im Berufsleben können die zugehörigen Ängste Probleme machen. Zum Beispiel, weil jemand gegenüber den neuen Kollegen sehr schüchtern ist oder weil er sich mit Networking schwertut – und es deshalb lieber lässt, auch wenn das für seine berufliche Entwicklung negativ ist.
Es ist wichtig, dass soziale Ängste in jungen Jahren erkannt und ernst genommen werden. Wer frühzeitig gegensteuert, kann lernen, die eigenen Gedanken und Verhaltensweisen in eine gesündere Richtung umzulenken – bevor eine richtige Sozialphobie daraus wird. Dabei ist es auch wichtig, dass das Umfeld die Betroffenen dabei unterstützt, sich ihren Ängsten zu stellen und daran zu arbeiten. Auch eine therapeutische Begleitung kann sinnvoll sein.
Tipps und Strategien, um soziale Phobien zu überwinden
Eine soziale Phobie kann sehr belastend für die Betroffenen sein – und ernsthafte negative Folgen für sie haben. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig eine Behandlung von sozialen Phobien anzustreben. Dazu brauchst du nicht zwingend professionelle Unterstützung, aber je weitreichender und tiefer gehender die Sozialphobie ist, desto sinnvoller kann das sein. Hier erfährst du, was du tun kannst, um deine soziale Phobie zu überwinden.
Im Akutfall: Entspannungstechniken und Atemübungen mit Sofortwirkung
Es kann lange dauern, bis man eine ausgeprägte Soziophobie so weit im Griff hat, dass sie im Alltag keine großen Probleme mehr bereitet. Bis dahin ist es wichtig, eine Strategie für herausfordernde soziale Situationen zu haben. Wenn du weißt, was du tun kannst, wenn dich deine sozialen Ängste zu überwältigen drohen, gewinnst du Kontrolle zurück.
Entspannungstechniken und Atemübungen sind simple, aber effektive Tools. Sie können dir sofort helfen, die psychische und körperliche Anspannung zu verringern, die bestimmte Situationen in dir auslösen. Hilfreich ist zum Beispiel Box Breathing: Dabei atmest du zum Beispiel vier Sekunden ein, hältst den Atem vier Sekunden, atmest vier Sekunden aus und hältst für vier Sekunden die Luft an. Du kannst auch andere Zeitintervalle nehmen; entscheidend ist, dass es sich nicht zu gezwungen anfühlt.
Das wiederholst du mehrfach. Auch bewusstes tiefes Atmen – am besten in den Bauch – beruhigt sofort. Es signalisiert deinem zentralen Nervensystem, dass alles in Ordnung ist, wodurch sich deine Aufregung mitsamt ihren körperlichen Begleiterscheinungen verringert. Eine nützliche Entspannungstechnik kann zum Beispiel progressive Muskelentspannung sein, bei der du systematisch verschiedene Muskeln erst an- und dann entspannst.
Sich den eigenen Ängsten stellen durch gezielte Konfrontation
Es ist wahrscheinlich das Letzte, was du tun möchtest, kann aber auch das effektivste Mittel gegen soziale Angst sein: Du stellst dich den Situationen, die du am liebsten vermeiden würdest. Du gehst zum Beispiel zu der Feier, die dir jetzt schon Magenschmerzen bereitet. Du meldest dich freiwillig für eine berufliche Rolle, durch die du stärker in den Mittelpunkt rücken würdest. Oder du verwickelst deine neuen Kollegen bewusst in Small Talk, statt Blickkontakt zu meiden und zu hoffen, dass dich niemand anspricht.
Exposition kann sehr effektiv sein im Umgang mit einer sozialen Phobie, aber es ist wichtig, dass du weißt, was du tust. Du solltest schrittweise vorgehen: Fange mit kleineren Herausforderungen an und steigere dich langsam. Mit jeder erfolgreich bewältigten Herausforderung wächst dein Selbstvertrauen und deine Ängste schwinden. Mit der Zeit wirst du dich immer sicherer und wohler in deiner Haut fühlen, sodass du dir immer mehr zutraust. Außerdem wirst du wahrscheinlich immer wieder die Erfahrung machen, dass die meisten Dinge gar nicht so schlimm sind, wie du sie dir im Vorfeld ausgemalt hast.
Psychotherapeutische Unterstützung
Die Unterstützung eines guten Therapeuten, dem du vertraust, kann bei einer sozialen Phobie zur Behandlung essenziell sein. Ein bewährter Ansatz ist die kognitive Verhaltenstherapie, bei der du deine Denkmuster erkennst und dein Verhalten schrittweise änderst. Du entwickelst gemeinsam mit deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin Strategien im Umgang mit deinen sozialen Ängsten – und stellst dich den Situationen, die dir Angst machen. Psychotherapie kann besonders effektiv sein, um selbstbewusster und sozial sicherer zu werden.
Selbsthilfegruppen
Ein weiterer Ansatz sind Selbsthilfegruppen. Sie können eine gute Lösung sein, wenn du (noch) keinen Therapieplatz gefunden hast oder nicht sicher bist, ob eine Therapie wirklich nötig ist. Der Austausch mit Menschen, denen es genauso geht wie dir, kann sehr aufbauend sein. In Selbsthilfegruppen hast du einen sicheren Raum, in dem du deine Erfahrungen mit anderen teilen und aus den Erfahrungen anderer lernen kannst. Das Gefühl von Gemeinschaft sorgt dafür, dass du dich weniger allein fühlst. Und wer weiß – vielleicht findest du dort sogar neue Freunde, bei denen du dich traust, wirklich du selbst zu sein.
Medikamente
Manchmal kann auch eine unterstützende medikamentöse Behandlung bei sozialen Ängsten sinnvoll sein. Zum Beispiel, wenn die soziale Phobie von Depressionen begleitet wird. Oder wenn die Betroffenen große Schwierigkeiten haben, ihren Alltag zu bewältigen. Wende dich an deine Hausärztin oder einen Psychotherapeuten, um eine mögliche medikamentöse Therapie bei sozialer Phobie zu besprechen.
Erfolgreich in Schule, Job und Studium trotz sozialer Ängste
Soziale Ängste können den Alltag in Schule, Job oder Studium zu einer Herausforderung machen. Es gibt jedoch Strategien, um trotz sozialer Phobien erfolgreich zu sein und die eigenen Ziele zu erreichen.
Ein Ansatz sind die schon erwähnten kleinen Schritte. Indem du dir immer etwas mehr zutraust, kannst du an Herausforderungen wachsen – und siehst, dass du mehr kannst, als du vielleicht gedacht hast. Dadurch gewinnst du an Selbstbewusstsein, was deine sozialen Ängste verringert. Zugleich ist es wichtig, dass du deine Grenzen kennst und sie auch ernst nimmst. Überfordere dich nicht, indem du dich kopflos in herausfordernde Situationen stürzt, sondern tue das wohldosiert. Dazu gehört auch das Wissen, dass es okay ist, wenn du dich mal einfach nicht danach fühlst. Du wächst auch dann, wenn du es doch nicht geschafft hast, dich im Unterricht zu melden oder auf neue Menschen auf einer Party zuzugehen – entscheidend ist, dass du dranbleibst und nicht aufgibst.
Um dein Selbstvertrauen zu stärken, solltest du darauf achten, wie du mit dir (gedanklich) sprichst. Oft haben wir gegenüber uns selbst einen wesentlich harscheren Ton als gegenüber anderen. Wenn du bewusst auf positive Selbstgespräche achtest, kannst du dich stärken und lernen, dich so zu akzeptieren, wie du bist.
Das richtige soziale Umfeld kann dir sehr helfen, den Alltag in Schule, Studium oder Job zu bewältigen. Wenn du gute Freunde, Kommilitonen oder Kollegen hast, die dich unterstützen und dir Wertschätzung entgegenbringen, fühlt sich vieles nicht mehr so schlimm an. Mit den richtigen Menschen an deiner Seite sind viele Situationen nicht nur weniger bedrohlich, sondern du hast auch jemanden, gegenüber dem du dich öffnen kannst.
Beängstigende Situationen vorher durchspielen
Es ist sinnvoll, dir für besonders herausfordernde Situationen – etwa eine mündliche Prüfung, eine Präsentation oder ein Vorstellungsgespräch – Strategien zurechtzulegen. Hier hilft es auch, den Ablauf zu kennen und ihn vorher durchzuspielen, damit er dir vertrauter ist. Es kann auch hilfreich sein, dir für soziale Situationen Themen zurechtzulegen, über die du mit anderen sprechen könntest, etwa auf einer Feier.
Nicht zuletzt kommt es auf deine Erwartungen an dich selbst an. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der persönlichen Entwicklung und der Selbstoptimierung ein hoher Wert beigemessen wird. Es ist zwar grundsätzlich gut, nach einer positiven Veränderung zu streben. Allerdings wird dabei manchmal übersehen, dass nicht jede Veränderung möglich ist. Wenn du ein schüchterner, introvertierter Mensch bist, wirst du womöglich nie zum Partylöwen werden. Entscheidend ist, diese Limitationen zu akzeptieren, anstatt etwas sein zu wollen, das man nicht ist. Die richtige Balance ist wichtig – wenn du zu viel von dir erwartest, baust du nur unnötigen Druck auf, der frustrierend und entmutigend sein kann.
Zögere nicht, dir Hilfe zu suchen. In der Schule gibt es zum Beispiel Vertrauenslehrer oder Schulpsychologinnen. Du kannst dich im Studium an die Studienberatung wenden oder dir psychotherapeutische Unterstützung suchen. Mit der richtigen Hilfe ist es leichter, deine sozialen Ängste zu verstehen und soziale Phobien zu überwinden.
Wann professionelle Unterstützung suchen?
Soziale Ängste können stärker oder schwächer ausgeprägt sein. Wenn du dich als regelrechten Sozialphobiker empfindest, der schon lange und besonders stark unter seiner sozialen Phobie leidet, ist eine professionelle Unterstützung womöglich die beste Lösung. Bei einer tiefgreifenden sozialen Phobie ist Therapie oft der vielversprechendste Ansatz. Natürlich kannst du es in vielen Fällen auch selbst schaffen – es ist aber mit der richtigen Unterstützung wesentlich angenehmer und leichter.
Wende dich direkt an Psychotherapeuten, um dich nach Therapiemöglichkeiten zu erkundigen. Du kannst auch bei einem Hausarzt danach fragen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Kontakt mit einer Beratungsstelle oder Selbsthilfegruppe aufzunehmen. Hier hilft eine Internetrecherche oder du erkundigst dich bei deiner Hausarztpraxis danach, welche Angebote es in deiner Nähe gibt.
Bildnachweis: Standret / Shutterstock.com